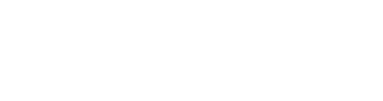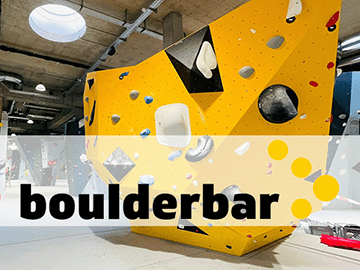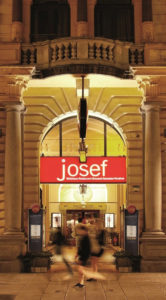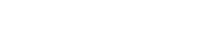Seit 2015 führt Vizebürgermeister Markus Hein das Infrastrukturressort. Ein LINZA Sommertalk über Brücken, Citymaut, Seilbahnen, Radlfahren und die Wahl 2021.
Markus Hein, starten wir gleich mal mit dem Thema Verkehr: Der Anteil der Fußgänger im öffentlichen Verkehr sank in den letzten 30 Jahren markant. Woran liegt das?
Genaue Untersuchungen dazu gibt es nicht. Ich denke aber, dass viele Fußwege länger geworden sind. Das betrifft das Einkaufen (Greislersterben) wie auch die Arbeit (Wegfall vieler kleinerer Gewerbebetriebe).
Der Radler-Anteil stieg dagegen kontinuierlich. Was ist hier noch drin?
Das Rad erhöht natürlich den Bewegungsradius. Mit dem E-Bike konnte die Reichweite sogar noch vergrößert werden. In Linz fahren über die Nibelungenbrücke bereits 750.000 Menschen mit dem Rad. Das entspricht ungefähr dem Fahrgastpotential der Mühlkreisbahn. Das zeigt deutlich, dass die getroffenen Maßnahmen Wirkung zeigen.
Kann das Fahrrad das Linzer Verkehrsproblem lösen?
Kein Verkehrsmittel – isoliert betrachtet – kann das Verkehrsproblem in Linz lösen, auch nicht das Fahrrad. Es müssen viele aufeinander abgestimmte Maßnahmen gesetzt werden. Priorität muss natürlich der Ausbau des ÖVs haben. Aber auch an der Siedlungspolitik im Umland muss sich was ändern. Siedlungsentwicklung soll nur noch entlang attraktiver ÖV-Korridore entstehen. Die Zersiedelungspolitik der Vergangenheit muss beendet werden.

Fast 70% der Zunahme des sog. „Motorisierten Individualverkehrs“ wird von Nicht-Linzern beigesteuert. Neben den neuen Bypässen der VOEST-Brücke ist auch der Westring in Bau. Kritiker sehen das als eine Einladung an alle Pendler, auch zukünftig aufs Auto zu setzen.
Die meisten Kritiker sind auf einem Auge blind. Denn ich muss mit dem hochrangigen Straßennetz Platz für die Innenstadt schaffen. Linz ist eine der wenigen Städte, die keine stadtnahe Umfahrung haben. Wenn ich den Verkehr aus der Innenstadt auf das hochrangige Straßennetz verlagere, kann ich den freigewordenen Platz in der Stadt für Radwege, Busspuren und lebensqualitätssteigernde Maßnahmen nutzen. Das muss natürlich parallel zum Bau des Westrings geschehen, damit der Verkehr nicht wieder zurück in die Stadt kann. Entlastungsmaßnahmen müssten dann bereits ab der Stadteinfahrt in der Rudolfstraße wirken.
Beim Wegfall der Eisenbahnbrücke hat man gesehen, dass sich die Pendler sehr schnell auf die neue Situation eingestellt haben und es zu keinem Verkehrskollaps gekommen ist. Braucht es nicht einfach da und dort mehr Zwang, um Verkehrsteilnehmer zum Umdenken zu bewegen?
Zwang ist der falsche Weg. Er sorgt nur für mehr Aggression unter den Verkehrsteilnehmern und führt unweigerlich zu einer Spaltung. Für mich ist die Wahlfreiheit des Verkehrsmittels sehr wichtig. Viele Menschen haben gar keine Möglichkeit, auf ihr eigenes Auto zu verzichten, weil ihr Wohn- oder Arbeitsort nicht gut durch den ÖV erschlossen ist. Die Betroffenen würden dann drei Mal so viel Zeit benötigen, um in die Arbeit oder nachhause zu kommen. Das ist unakzeptabel. Wir müssen zuerst im Großraum Linz das Angebot deutlich verbessern. Das Mobilitätsleitbild ist der erste wesentliche Schritt in diese Richtung.

Eine Citymaut, um Verkehrsströme zu lenken: Wäre das für Sie jemals ein Thema?
Die Citymaut ist für mich kein Thema. Wenn das Angebot passt, werden auch mehr Menschen auf den ÖV setzen. Niemand darf, weil die Möglichkeiten noch nicht vorhanden sind, bestraft werden.
Ist Autofahren zu billig?
Nein! Der ÖV ist für viele einfach zu unattraktiv. Das wird auch das 1-2-3-Ticket nicht ändern. Wer mindestens doppelt so lange mit einem öffentlichen Verkehrsmittel als mit dem Auto an Zeit benötigt, wird auf das Auto nicht verzichten. Ich würde es in dem Fall sicher auch nicht tun.
Nach der nächsten Gemeinderatswahl 2021 stehen die Chancen einer rot-grünen oder rot-grün-pinken Zusammenarbeit sehr gut. Da könnte auch der Weiterbau des Westrings durch ein Linzer Veto gekappt werden. Wie sehen Sie dieses Szenario?
Das ist reines Kaffeesudlesen. Welche Mehrheiten sich nach der Wahl 2021 ausgehen, wird der Wähler entscheiden. Fakt ist aber, dass ein Westring-Stopp ein Schildbürgerstreich wäre, der seinesgleichen erst auf der Welt finden müsste. Außerdem hat sich die grüne Verkehrsministerin bereits zum Westring bekannt. Ich gebe aber zu bedenken: Kein Westring heißt aber auch keine Verkehrsberuhigung in der Innenstadt. Die Autos werden sich – wenn man realistisch und nicht verträumt ist – nicht von alleine auflösen.
Nach dem letzten Verteuerungsschub muss die Stadt Linz mindestens 37 Millionen Euro zum Westring beisteuern. Dabei wird es möglicherweise aber nicht bleiben, weil Linz 5 Prozent der Baukosten tragen muss. Sind hier Nachverhandlungen mit der ASFINAG ein Thema? Schließlich kommt der Westring fast ausschließlich den Pendlern zugute.
Der Westring kommt nicht nur den Pendlern zu Gute. Der Stau macht beim Kennzeichen keinen Unterschied. Für Linz ist der Westring deshalb von Bedeutung, weil er uns für Verkehrsberuhigungsmaßnahmen in der Innenstadt den notwendigen Platz verschafft. Kostenerhöhungen sind nie erfreulich, aber bei Projekten dieser Größenordnung auch nicht ungewöhnlich.
Gibt es eine Summe, bei der Sie beim Westring die Reißleine ziehen würden?
Ich gehe davon aus, dass sich die Kosten nicht mehr wesentlich erhöhen werden. Je detaillierter die Planung, desto realistischer sind die Kosten.
Knackpunkt beim Pendlerverkehr wird der Bau der beiden S-Bahn Linien durch das Stadtgebiet werden. Wann wird es die Gespräche mit dem zuständigen Ministerium bezüglich der Kostenbeteiligung des Bundes geben?
Federführend ist das Land Oberösterreich, dieses ist auch mit dem Bundesministerium im Kontakt. Termin wurde seitens des Ministerium noch keiner vergeben – das ist zumindest mein Wissenstand.
Linz wird zumindest 25 Prozent der Kosten tragen müssen. Leere Kassen, jetzt noch das Corona-Loch im Budget: Wie soll sich das ausgehen?
Es ist notwendig, dass der Bund mindestens 50 Prozent der Kosten übernimmt. Der Rest wird zwischen Land und Stadt im Verhältnis 80:20 aufgeteilt und das natürlich auch nur für den Teil, der auf Linzer Stadtgebiet verläuft. Natürlich ist es finanzierbar, Geld ist genug da, die Prioritäten müssen sich bei der Verteilung ändern.

Was ist der Plan B, falls der Bund keine Mittel beisteuert und die Stadtbahn nicht kommt?
Es wird keinen Plan B brauchen. Es wäre ja „lustig“, wenn gerade die Grünen, die den Ausbau des ÖVs massiv gefordert haben, wo sie in Regierungsverantwortung sind, nun diesen begraben würden. Das wäre die größte Wählertäuschung in der Nachkriegsgeschichte.
Wie stehen Sie zur geplanten Ostumfahrung und die festgelegte Trasse?
Es ist wichtig, dass wir Trassen sichern. Das wurde in der Vergangenheit leider zu wenig berücksichtig. Wir haben natürlich eine umweltfreundliche Alternative zur Ostumfahrung, das wäre die Linzer Stadtseilbahn. Diese würde die Straßen im Süden von Linz erheblich entlasten und auch das Industriegebiet. Mit Kosten von 150 Mio. Euro wäre sie auch wesentlich günstiger. Fakt ist aber, dass wir eine Verkehrslösung im Süden brauchen. Denn die Bautätigkeiten im Umland sind zum Teil sehr konzeptlos. Es werden größtenteils nur Wohnungen gebaut. Wo aber die Menschen Arbeit finden, darum kümmert man sich leider wenig. So ist es naheliegend, dass viele nach Linz einpendeln werden.
Hat das visionäre Zukunftsprojekt einer Stadtseilbahn im aktuellen finanziellen Umfeld überhaupt noch eine Chance?
Natürlich! Zehn Kilometer Seilbahn kosten 150 Mio. Euro, der jährliche Betrieb liegt bei 2,9 Mio. Euro. Die Betriebskosten sind jene, auf die wir achten müssen, denn eine Investition ist irgendwann abbezahlt, der Betrieb nicht. Ein kleiner Vergleich: Die Betriebskosten der neuen Obuslinien 47 und 48 liegen bei ca. 12 Mio. Euro pro Jahr. Die Seilbahn ist da unschlagbar.
In Linz ist der ÖV auch ohne Seilbahn relativ gut erschlossen. 86% des Stadtgebietes gelten laut Statistik Austria als „gut bzw. sehr gut erschlossen“. Was fehlt im Angebot für die Linzer Bevölkerung dennoch?
Die Achillesferse ist sicher das Industriegebiet. Da gibt es noch mehr Luft nach oben. Mit den neuen Buslinien 13 und 14, sowie weitere Verbesserungen der bestehenden Linien würden wir aber auch diese Problemzone beseitigen.
Sehr gerne, ja fast schon inflationär wird das Thema Drohnen als zukünftige Problemlöser im städtischen Nahverkehr genannt. Ist das angesichts der enormen Verkehrsströme in Linz nicht Augenauswischerei?
Nein, sie sind sicher nicht die Problemlöser. Aber ein innovativer Ansatz, dem wir uns nicht verschließen sollten.
Als Sie 2015 das Infrastrukturressort übernommen haben, gab es bei manchen politischen Mitbewerbern diebische Freude. „Der Hein wird sich einen Bruch heben“, hieß es hinter vorgehaltener Hand. Wie lautet Ihre Bilanz nach fünf Jahren?
Es ist sowohl in der Stadt- wie auch in der Verkehrsplanung einiges weitergegangen. Wir bauen vier neue Donaubrücken und haben eine Einigung mit dem Land zu den beiden neuen Stadtbahnen und Obuslinien erreicht. Zudem die stetige Attraktivierung des ÖVs mit neuen Obussen, mehr Busspuren und andere Beschleunigungsmaßnahmen. Für Radfahrer wurde in Linz noch nie so viel gemacht – auch nicht unter grüner Regierungsverantwortung. Wir haben nun ein Mobilitätsleitbild, das erstmalig mit dem Land Oberösterreich gemeinsam erstellt wurde. Jährlich bauten wir 1.000 neue Wohnungen, um die Wohnkosten zumindest stabil halten zu können. Das kooperative Planungsverfahren wurde unter meiner Führung mehrfach eingesetzt. Mit der städtebaulichen Kommission habe ich die Stadtplanung aus dem Reagieren ins Agieren geführt. Die Stadt-Strategie, die gerade in Umsetzung ist, wird auch die Bürgerbeteiligung auf ein ganz neues Level stellen. Alle 1.000 Bebauungspläne bekommen ein Klimapaket, wie es dies in ganz Österreich noch nicht gibt.
Und nach der Wahl 2021: Würden Sie das Infrastrukturressort nach diesen intensiven Jahren gerne abgeben oder eintauschen?
Das Infrastrukturressort ist ein sehr spannendes Ressort, das wird sich auch in den nächsten Jahren nicht ändern. Schlussendlich entscheidet aber der Wähler.
Apropos Wahl: Nach 2021 werden die politischen Karten neu gemischt. Es werden wohl einige neue Konstellationen möglich sein. Würden Sie wieder auf einen rot-blaue Zusammenarbeit setzen?
Ich arbeite mit jedem, der konstruktiv ist, gerne zusammen. Eine wichtige Eigenschaft in der Politik ist für mich die Handschlagsqualität. Wer diese hat, mit dem wird auch zusammengearbeitet. Schließlich haben wir in der Stadt eine Proporz- und keine Koalitionsregierung.
Interview: Wilhelm Holzleitner