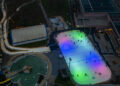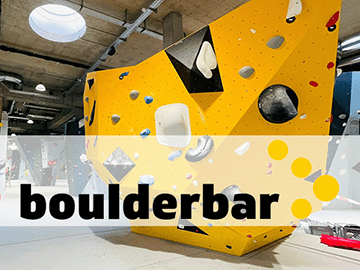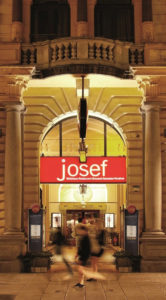Die gebürtige Grazerin Elfriede Rebernik (81) aus Linz gehört zu jener Generation, die noch im Krieg geboren wurde und in einer Zeit aufwuchs, die von großen Entbehrungen gezeichnet war. Das heutige Gejammer über „Krisen“ kann sie nicht nachvollziehen.
Vier Kinder, alle rund um den Zweiten Weltkrieg geboren, umfasste die Familie Hammerl (Mädchenname) aus Graz. Seit bald 50 Jahren lebt Elfi Rebernik nun in Linz. Wenn sie heute das Wehklagen über die Corona-Krise hört und immer wieder Parallelen mit der Kriegszeit gezogen werden, kann sie nur den Kopf schütteln.
Frau Rebernik, wie waren Ihre Lebens-und Familienverhältnisse damals zur Kriegszeit?
Wir waren drei Mädchen, die vor oder im Krieg geboren wurden – 1936, 1939 und 1942. Meine Mutter zog uns auf, während die Fliegerbomben auf Graz fielen. Die jüngste Schwester, Herta, kam 1948 zur Welt.
Haben Sie auch noch Erinnerungen an die Kriegszeit selbst?
Ja, als wir bei einem der letzten Bombenangriffe aus Graz geflohen sind, nach Ligist auf einen Bauernhof. Wir haben dort wochenlang im Stroh geschlafen. Den Geruch vom Heu und vom Stall habe ich heute noch in der Nase. Jedesmal wenn ich auf einem Bauernhof bin und das rieche, habe ich die Bilder von damals im Kopf. Das hat sich für immer eingeprägt.
„Nach dem Krieg gab es wochenlang keinen Strom oder Wasser. Wenns zum Waschen war, stellte meine Mutter eine kleine Blechwanne in der Küche auf und wir wurden runtergewaschen.“
Und als Sie dann nach Graz zurückgekommen sind – wie war es da?
Auch unser Haus beim Jakominiplatz im Zentrum wurde von einer Fliegerbombe getroffen. Die oberen zwei Stockwerke waren zerstört, unsere Wohnung im ersten Stock blieb halbwegs heil. Die Schäden waren erst zehn Jahre nach dem Krieg ganz beseitigt.
Wie waren Ihre Wohnverhältnisse?
Mein Vater war Zollbeamter, darum wohnten wir relativ gut, wir hatten 60 Quadratmeter und sogar Wasseranschluss und ein WC in der Wohnung. Das war damals absoluter Luxus. Nach dem Krieg gab es wochenlang keinen Strom oder Wasser. Wenns zum Waschen war, stellte meine Mutter eine kleine Blechwanne in der Küche auf und wir wurden runtergewaschen. Das heiße Wasser kam vom Kohleherd.
Haben Sie Erinnerungen an ihre ersten Weihnachten?
Irgendwie schaffte es mein Vater, von einem Bauern ein Hendl zu organisieren. Das war ein unglaubliches Festessen, das wir uns zu sechst teilen mussten. Schon Wochen vorher haben wir unsere Mama angebettelt, weil jeder ein Haxerl haben wollte, aber nur zwei davon da waren.
„Eines meiner ersten Weihnachtsgeschenke war eine selbstgestrickte Unterhose.“
Und was lag unterm Christbaum?
Eines meiner ersten Geschenke war eine selbstgestrickte Unterhose. Die war so grob gestrickt, dass ich am Abend das ganze Muster auf der Haut hatte. Das war damals so: Es gab nur Selbstgstricktes. Was ganz Besonderes war ein Puppenhaus, das uns ein Nachbar, der gerne bastelt, geschenkt hat.

Und gibt‘s auch eine besondere Erinnerung an die Nachkriegszeit?
Mein Vater war Zollbeamter. Einmal hat er von einer Waggonladung Bananen drei Stück mitnehmen dürfen. Das war für uns wie von einer anderen Welt. Es mangelte an allem, selbst an Milch, Brot und den einfachsten Dingen. Mein Vater ging immer wieder „Hamstern“ – das waren illegale Märkte, wo man Möbel, Schmuck oder andere Dinge gegen Essbares tauschte. Essen war die kostbarste Währung überhaupt. 1950 durften meine Schwester Hilda und ich dank der Caritas für ein Jahr zu Pflegeeltern nach Portugal. Auf der Reise dorthin hab‘ ich meine erste Orange gegessen. Ich fühlte mich wie im Paradies. Beim Abschied bekam ich ein goldenes Amulett, das ich heute noch trage.
Weil wegen Corona oder wegen dem hohen Benzinpreis ständig von einer „unvergleichlichen Krise“ die Rede ist: Wie empfinden Sie diese Einschätzung?
Ich war erschüttert. Das ist keine Krise, wenn die Plus City-Geschäfte ein paar Wochen zu haben oder wenn das Benzin 1,70 Euro kostet. Es geht den Menschen heute viel zu gut. Ich kann es aber keinem verdenken, weil er es nicht anders kennt. Ich wünsche keinem, dass er so eine Zeit wie wir durchmachen muss.