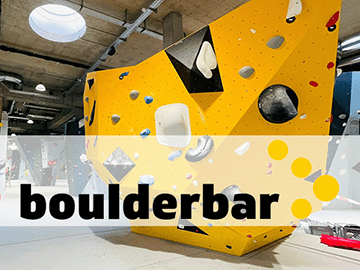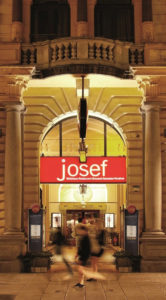Zur allgemeinen Überraschung hat Blau-Weiß Linz Sportchef David Wimleitner das Handtuch geworfen. Nach einer Über-Saison in der dritthöchsten Spielklasse, an deren Ende der verdiente Aufstieg in die Erste Liga stand. Und zu einem Zeitpunkt, an dem Wimleitners Beliebtheitswerte nicht höher hätten sein können. Damit wiederholt sich ein Spiel, das es bereits einige Jahre zuvor schon gab. Auch damals kündigte mit Gerald Perzy ein ähnlich charismtischer sportlicher Leiter. Auch damals aus demselben Grund: einer bis zur Unerträglichkeit eingeschränkte Handlungsfreiheit.
Der mittlerweile 70-jährige Hermann Schellmann ist ein Unternehmer der alten Schule. Auch den Klub führt er seit seiner Neugründung 1997 mit denselben Instrumentarien, die er aus dem vorigen Jahrtausend mitgenommen hat: Der Fanartikel- und Kartenvorverkauf etwa wird immer noch mit handgeschriebenen Listen und Wechselgeld aus der Keksdose (!) vollführt, eigene Klubräume gibt es bis heute nicht, der Verein „wohnt“ zur Untermiete in Shellmanns Büro. Und während es andere, vergleichsweise nur mit dem Mikroskop wahrnehmbare Fußballklubs es schafften, sinnvoll in die Infrastruktur zu investieren und sich so wunderschöne Heimstätten bauten, gammelt das Donauparkstadion des FC Blau-Weiß Linz seit 20 Jahren quasi unverändert vor sich hin. Jeden Wunsch nach Optimierung oder Verbesserung schmetterte der allmächtige Präsident ein ums andere mal ab. Visionen, wo der Klub überhaupt hin will oder das Schaffen bleibender Werte waren und sind Schellmanns Stärken nicht. Es wird vielmehr von Saison zu Saison anlassbezogen geplant. Eine Idee oder gar einen Plan, wie man etwa das erwähnte Donauparkstadion zukunftsfit machen könnte, gibt es bis heute nicht mal in Ansätzen.

Dem FC Blau-Weiß Linz geht’s wie Niki Lauda anno dazumal: Er fährt ständig im Kreis, bewegt sich so aber nicht weiter. Seit 1997 hat sich quasi nichts verändert, der Klub wird immer noch so geführt, wie es ältere Semester aus den 70er-Jahren des vorigen Jahrtausends kennen: Einer schafft an, alle anderen springen. Diesen Führungsstil haben mittlerweile alle halbwegs bedeutenden Vereine überwunden – alle, bis auf einen.
Erlaubt sich einer der Mitarbeiter im Klub zu viel eigene Meinung oder steigt dessen Beliebtheit beim Anhang, mündet das in einem präsidialen Bannstrahl, an dessen Ende die verzweifelte Selbstkündigung des Betroffenen steht. Wirklich länger halten konnten sich im Verein meist nur jene, die relativ meinungsfrei ihr Tagwerk taten und den konzeptlosen Kurs des Präsidenten nicht hinterfragten – und natürlich die liebe Familie. Schellmanns Gattin reißt die Karten beim VIP-Eingang ab und schenkt dort auch aus, seine Söhne verdingen sich als eine Art Sachbearbeiter und erledigen Helferdienste. Eine rührige Familienshow, aber professionell geht wahrlich anders.
Bleibt die Frage: Welchen Sinn macht das alles? Warum macht Hermann Schellmann das? Warum vermeidet er es seit Jahren geschickt, moderne Strukturen zuzulassen? Oder einen Nachfolger aufzubauen? Warum wehrt er sich trotz seiner 70 Jahre mit Händen und Füßen, Macht abzugeben oder den Weg Stück für Stück freizumachen, um den Klub ENDLICH an die nächste Generation zu übergeben? Will er 150 werden? Oder glaubt er an die Unsterblichkeit? Statt sein Lebenswerk zukunftsfit zu machen, fuhrwerkt er lieber beratungsresistent in den uralten Mustern weiter. Der Klub mit dem großen Herzen und dem noch größeren Fan-Potenzial könnte heute ganz woanders stehen. Selbst der Abstieg aus der Ersten Liga vor einigen Jahren – der genau dieser Art von Klubführung geschuldet war – veranlasste Schellmann nicht, seinen Kurs zu ändern. Er hat wie immer alles richtig gemacht… aus seiner Sicht – und eine andere existiert in der Welt eines Hermann Schellmann nicht. Er kann wohl nicht anders, selbst wenn er wollte.
Ganz nebenbei ruiniert er seinen Ruf als Retter des blau-weißen Fußballs. Schade und traurig, dieser Selbstmontage zuschauen zu müssen. Hermann Schellmann hat es immer noch selbst in der Hand, als ein ganz Großer in die Geschichte des oberösterreichichen Fußballs einzugehen. Um in der Kickersprache zu bleiben: Irgendwann muss Schluss sein mit den ständigen Eigentoren. Ein guter Kapitän weiß, wann er sich austauschen lassen muss.