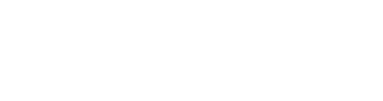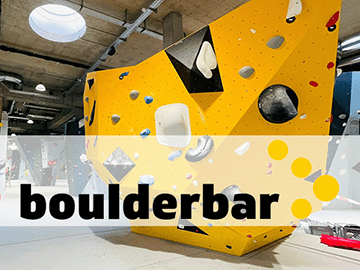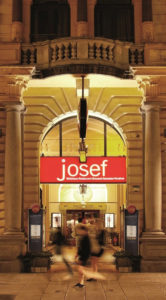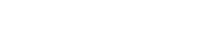Anfangs zuckelte sie noch ächzend den Linzer Hausberg hoch, mittlerweile surren Triebwägen der neuesten Generation auf den Pöstlingberg. 125 Jahre ist es her, als die immer noch steilste Adhäsionsbahn der Welt eröffnet wurde. Ihre bewegte Geschichte ist mehr als spannend.
Seit Mitte des 18. Jahrhunderts war der Pöstlingberg das Ziel von Wallfahrern, ab dem Ende desselben Jahrhunderts wurde der Berg zunehmend auch von Ausflüglern frequentiert, besonders nachdem die Gipfelregion aus militärischen Gründen 1809 und in den 1830er Jahren abgeholzt wurde und dieser eine beeindruckende Aussicht freigab. Das ließ den Bau einer Bergbahn lohnend erscheinen, wie sie gegen Ende des 19. Jahrhunderts auch in anderen Städten projektiert wurden.
„Geplant war ursprünglich eine Zahnradbahn, gebaut wurde schließlich eine Adhäsionsbahn – heute immer noch die steilste der Welt“
Für den Pöstlingberg entwickelte der Ingenieur Josef Urbanski 1891 das Projekt einer dampfbetriebenen Zahnradbahn. Urbanski fand zwar viel ideelle, aber kaum finanzielle Unterstützung. Er konnte einen Trassenentwurf in Eigenregie fertigstellen und verband sich 1893 mit der Wiener Baufirma Ritschl & Co.

Ritschl wurde andererseits Mitglied des 1895 von Dr. Carl Beurle gegründeten Consortiums für die Errichtung elektrischer Anlagen in Linz, dem auch die k.k. priv. Länderbank Wien und die Union-Elektricitäts-Gesellschaft Berlin angehörten. Ziel des Konsortiums war
• der Bau eines Dampfkraftwerks,
• die Elektrifizierung der Linzer Straßenbahn und
• der Bau einer elektrischen Adhäsionsbahn auf den Pöstlingberg.
Damit geriet Urbanskis Zahnradbahnprojekt in den Hintergrund. Einzig die Trassierung stützte sich teilweise auf Urbanskis Trassenentwurf, ohne dass dessen Verdienste gebührend anerkannt wurden. Er strengte schließlich sogar einen Prozess um seine Urheberschaft an dem Projekt an, verlor diesen aber. Von der Gemeinde Urfahr erhielt er die vergleichsweise geringe Summe von 100 Gulden als Entschädigung für seine Trassierungskosten. Tief enttäuscht verließ er 1897 Linz.

Um die Attraktivität des Pöstlingbergs als Ausflugsziel zu erhöhen und den elektrischen Strom in der Bevölkerung zu bewerben, plante man neben dem Bau der Bergbahn eine entsprechende Umgestaltung der 1883 desarmierten Befestigungsanlage auf dem Pöstlingberg. Die neu gegründete Tramway- und Elektrizitäts-Gesellschaft Linz-Urfahr (TEG), die Vorläuferin der heutigen Linz AG Linien, erwarb die Besitzrechte des Geländes. Turm IV der Festungsanlage wurde zur Bergstation der Pöstlingbergbahn, das Verdeck des Turms V wurde zur Aussichtsplattform umgestaltet. An der Festungsmauer zwischen Turm VI und Turm I wurde das Bergbahn-Hotel (heute das Pöstlingbergschlössl) errichtet. 1906 wurde im Turm II schließlich die Grottenbahn eröffnet.
Konzessionierung wie Baubeginn bei der Bergbahn erfolgten 1897. Am Pfingstsonntag, dem 29. Mai 1898 stieg die Eröffnung. Die 2.880 Meter lange Pöstlingbergbahn war zunächst als reine Ausflugsbahn für den Sommerbetrieb konzipiert, weshalb zunächst nur sechs offene Sommertriebwagen beschafft wurden. Doch schon im ersten Betriebsjahr fuhr man bei schönem Wetter bis in den Dezember. Bereits 1899 wurden daher zusätzlich zwei geschlossene Triebwagen beschafft.
Acht Wochen nach Streckeneröffnung übernahm die Bahn, zwei Mal täglich, den Taltransport der auf dem Pöstlingberg anfallenden Briefpost. Der Postzug verließ die Bergstation um 9:50 Uhr sowie 20:12 Uhr.
Nachdem im Jänner 2005 bei der Haltestelle Schableder ein Wagen der Pöstlingbergbahn entgleist war, begann eine Diskussion hinsichtlich der Sicherheit. Der damalige Bürgermeister Dobusch schlug vor, die Bahn umzuspuren und bis zum Hauptplatz zu führen, bis dahin befand sich die Endstation bei der Endhaltestelle der Straßenbahnlinie 3 nahe des Mühlkreisbahnhofs.
Im Juli 2006 wurde die Modernisierung der Pöstlingbergbahn beschlossen, im Mai 2009 erfolgte die Eröffnung. Die wichtigste Änderung war die Umspurung auf 900 Millimeter. Die Gleise wurden dazu komplett neu gebaut, zusätzlich wurden drei neue Niederflurtriebwagen beschafft. Diese Fahrzeuge wurden in einem „Retro-Design“ gestaltet, daneben wurden drei Alttriebwagen mit neuen Untergestellen ausgerüstet.
Die Gesamtkosten für den Umbau betrugen 35 Millionen Euro (20 Millionen für die Fahrzeuge und 15 Millionen für den Umbau der Strecke selbst sowie der neuen Endstelle auf dem Hauptplatz).
Fahrgastzahlen
Die Frequenz entwickelte sich bis zum Ersten Weltkrieg langsam nach oben auf knapp über 200.000 Fahrgäste pro Jahr. In den Kriegs- und unmittelbaren Nachkriegsjahren stiegen die Fahrgastzahlen wegen der „Hamsterfahrten“ der Städter aufs Land sprunghaft bis auf 688.000 Reisende (1918) an. In den 1920er Jahren pendelten die Fahrgastzahlen um die 400.000 jährlich und sanken in den 1930er Jahren auf 300.000 jährlich.
In der Kriegs- und Nachkriegszeit des Zweiten Weltkriegs erreichten die Beförderungszahlen Rekordwerte, 1943 wurden beispielsweise 1.264.000 Fahrgäste befördert. Bis Mitte der 1950er Jahre schwankten die Zahlen zwischen knapp 1,0 und 1,1 Millionen Fahrgästen. Seitdem ist ein stetiger Rückgang zu verzeichnen. Heute benutzen jährlich circa 500.000 Personen die Bahn.
Quelle: wikipedia